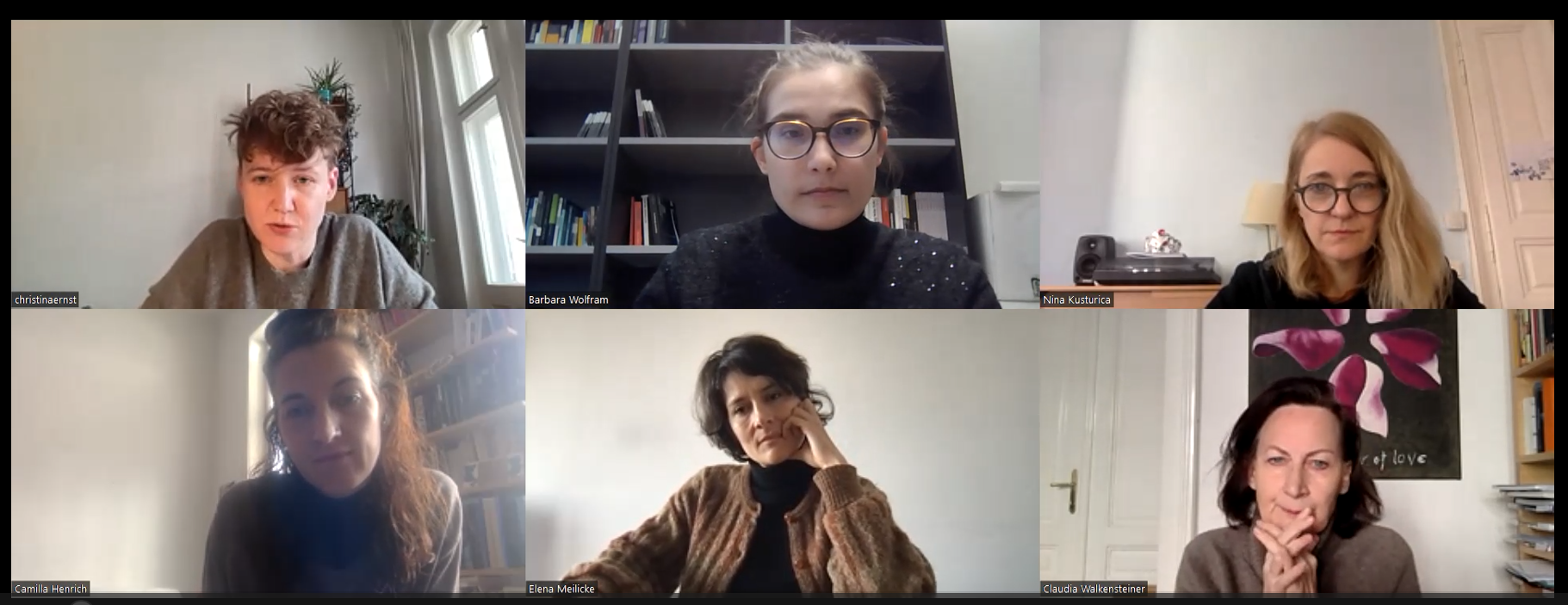Kolloquium IV
Christina Ernst
“Autosoziobiographisches Schreiben und die Funktion der Fotografie. Zur Poetik von Annie Ernaux, Didier Eribon und Éduard Louis”
Christina Ernst ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin. In ihrem Dissertationsprojekt am Institut für Romanistik der Universität Wien forscht sie unter dem Arbeitstitel »Écrire dans la langue de l’ennemi. Herkunft, Klasse und Gewalt in den autosoziobiographischen Texten der französischen Gegenwartsliteratur«. Neben der Beschäftigung mit Autobiographie und Autosoziobiographie bzw. Theorien zur Klasse liegen ihre weiteren Arbeitsschwerpunkte bei deutschsprachiger und französischer Gegenwartsliteratur, Comic-Forschung und Queer Theory.
Kolloquium IV – Christina Ernst
30.01.2024 – 10-12 Uhr, online
Bei dem Kolloquium verband Christina Ernst eine theoretische Rahmung mit künstlerischem, spezifischem Material. Der Vortrag eröffnete mit Überlegungen zur Poetik der Autosoziobiographie und Thesen aus ihrer Forschung zu Annie Ernaux’, Éduard Louis’ und Didier Eribons Texten, hinsichtlich der Schreibweisen in Kombination mit politischen Haltungen, einem signifikanten Schreibstil und den Erklärungen der eigenen Methodik der Autor*innen. Daran anschließend zeigte Ernst konkreteres (fotografisches) Material und kam auf die Funktion der Fotografie in Autosoziobiografien, als Öffnung eines „autobiografischen Raums“ (Ernaux) bzw. zum Vollzug einer „Autosozioanalyse“ (Eribon), zu sprechen. Alle Zitate, wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich auf Ernsts Ausführungen.
Bei literarischen Autosoziobiografien, so Ernst, handelt es sich um autobiografische Texte an der Schnittstelle zwischen literarischem, historischem und soziologischem Erzählen. Es werden Themen wie Herkunft, Klasse, Bildung sowie eine mögliche Distanz und Entfremdung zur Ursprungsfamilie verhandelt. Durch eine spezifische Schreibweise, die als „platt“ (Ernaux), „theoretisch-essayistisch“ (Eribon) bzw. „konfrontativ“ (Louis) bezeichnet wird, wollen die Texte „einerseits weniger und damit aber zugleich auch mehr sein als Literatur“. Durch die Abkehr von der Fiktion soll die soziale Wirklichkeit, eine Wahrheit beschrieben werden. Dies erfolgt mittels einer dokumentarischen Schreibweise: „Die Wirklichkeit der Klassen, der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse und die soziale Wirklichkeit der Herkunftsklasse soll möglichst nicht literarisch oder künstlerisch verzerrt oder verfremdet werden, weder beschönigend dargestellt noch als Schreckensbild gezeichnet werden.“, führt Ernst aus. Hierfür liegt ein „Rückgriff auf historische Dokumente oder auf Archivmaterial, was einerseits Zeitungsartikel oder Briefe oder Tagebucheinträge sein können, und vor allem die Fotos“ nahe.
Ein weiteres Merkmal des hier verhandelten autosoziobiografischen Schreibens ist die Reflexion der eigenen Position, von der aus erzählt wird, nämlich der von Klassenübergänger*innen (vgl. Chantal Jaquets Transclasse). „Der/die Transclasse kennt, in einer dichotomischen Gesellschaftsstruktur gedacht, beide sozialen Welten und fungiert damit in einer Art Übersetzer*innen-Funktion, der/die ein spezifisches Wissen über die ärmeren, prekarisierten und abgehängten Bevölkerungsschichten hat.“, postuliert Ernst in dem Vortrag. Sie unterstreicht dabei, dass „die Autor*innen beim Schreiben nicht als souveränes Autorensubjekt über dieses spezifische Wissen verfügen, es geht eher um eine Recherche, um ein Untersuchen, Annähern.“
Wenn Ernaux davon schreibt „Ethnologin meiner selbst“ zu sein, es ihr darum gehe, ihr Ich „in einer weiteren Wirklichkeit zu verlieren“ oder Eribon sein Schreibkonzept als eine reflexive „Rückkehr“ bezeichnet, also eine soziologische Introspektion unternimmt, wird deutlich, dass Autosoziobiographien nach einer sozialen Realität suchen, anstatt diese bloß zu erzählen. „Die Erkenntnis über die soziale Wirklichkeit – und damit ist auch die eigene Vergangenheit gemeint, eben als Klassenvergangenheit – ist dem Schreibprozess also nicht vorgängig, sondern muss im Schreiben (re-)konstruiert werden. In diesem Prozess müssen auch die eigenen Erinnerungen, die eigenen Affekte wie Archivmaterial behandelt werden.“
Fotografien als Beweismaterial
Für Christina Ernst dienen den Autor*innen neben dem Tagebuch und Kalender, vor allem Fotografien als konkretes Archivmaterial: „Sie haben einen besonderen Stellenwert in den autosoziobiografischen Texten, haben einen Evidenzcharakter, wie eine Spur der Vergangenheit. In der Rezeption – vor allem dann, wenn sie mit abgedruckt sind – haben sie einen Realitätseffekt, der quasi das Geschriebene in einem anderen Medium noch mal beglaubigt oder verstärkt.“ Das Betrachten von Fotografien markiert außerdem, so Ernst, einen Einsatzpunkt des Erzählens, bei dem über die eigene Herkunft nachgedacht wird (vgl. Didier Eribon in „Rückkehr nach Reims“).
Annie Ernaux‘ Texte betreffend, wendet Ernst den Begriff der „fotosoziobiographischen Schreibweise“ (Katharina Sykora) an: „Diese Textstellen funktionieren wie eine Art literarischer Schnappschuss. Die Fotos werden beschrieben, als würde sie uns jemand direkt vor die Augen legen. Ernaux schreibt: Auf dem Foto sehe ich… und fährt fort mit einer Beschreibung. Es ist quasi das Aufrufen einer realen Vorlage. Die fotosoziobiografischen Textstellen statten das, was beschrieben wird, mit dem Wirklichkeitstopos der Fotografie aus. Sie suggerieren, man würde diese Fotos wirklich sehen.“ Ernst erklärt, dass beinahe alle Texte von Annie Ernaux Fotobeschreibungen beinhalten, aber immer ohne dem Abdruck dieser herausgegeben wurden. Erst in „Ercire la vie“, einer Art Werkausgabe, veröffentlichte Ernaux Tagebucheinträge und private Fotografien. Teilweise auch jene, die sie zuvor in ihren Büchern beschrieben hatte.
Des Weiteren dienen Fotobeschreibungen bei Ernaux auch dazu, Diskontinuitäten und Nicht-Identität zu markieren, führt Ernst am Beispiel einer Textstelle in „Erinnerungen eines Mädchens“ aus: „Ernaux schreibt: Ich betrachte das schwarzweiße Ausweisfoto. (…) Ist sie ich, dieses Mädchen? Bin ich sie? (…) Natürlich dürfte ich nichts von der Zukunft wissen. Das Mädchen auf dem Foto bin nicht ich, aber sie ist auch keine Fiktion. Durch diese zeitliche Distanz und Diskontinuitäten kann Ernaux in ihrem Text auch von „sie“ anstatt von „ich“ sprechen, das vergangene „Ich“ als ein anderes betrachten und eine Distanzierung einziehen. Auf dieses vergangene „Ich“ wendet sie so etwas wie einen ethnologischen Blick an oder etwas, das man als nachträgliche teilnehmende Beobachtung bezeichnen könnte. Es ist ein Versuch der Objektivierung der vergangenen Ereignisse als sozial markierte Ereignisse.“
Auch für Didier Eribon haben Fotografien einen wichtigen Stellenwert, belegt Ernst mit folgendem Zitat: „Die Rückbesinnung auf eine Familien- und Sozialgeschichte muss sich geradezu auf das Betrachten alter Fotografien stützen. Die Kraft ihrer Evidenz ist ungebrochen: Mit Erinnerungen kann man tricksen, mit Fotos nicht. Egal wie schlecht oder ob man sich gar nicht mehr erinnert, sie zeigen die Welt so, wie sie war. Nicht als Wille, sondern als Vorstellung: das Reale, wie es gewesen ist.“
Ernst erklärt hierzu, dass genau „diese Evidenz des Realen, und vor allem auch die soziale Einschreibung dieses Realen“ dazu führte, dass er seinen Vater aus dem Bild, das auf dem Umschlag der deutschen Ausgabe sowie der französischen Taschenbuchausgabe abgedruckt wurde, geschnitten habe. „Eben weil die Präsenz des Vaters im Bild eine Spur der sozialen Herkunft ist, die in ihm fortwirkt. Er benennt es auch als die anhaltende Wirkung der Scham, die selbst dann noch fortwirkt, wenn man sie eigentlich soziologisch-theoretisch analysiert und durchdrungen hat. (…) Der Vater ist nur am untersten linken Rand in so einem Hemdzipfel doch noch irgendwie gleichzeitig abwesend und präsent. Man sieht hier eine Spur von dem, was das Foto ursprünglich auch noch abgebildet hatte.“, so Ernst.
Zuletzt präsentiert Ernst in ihrem Vortrag Beispiele zu Éduard Louis‘ Einsatz von Fotografien in seinen Werken „Die Freiheit einer Frau“ und „Wer hat meinen Vater umgebracht?“ und stellt fest: „Die Fotobeschreibungen werden auf der Erzählebene immer als zufällige Funde beschrieben. Die Integration von Fotobeschreibungen markiert einen Wendepunkt in Louis‘ Schreibweise, vor allem im Vergleich zu seinen früheren Texten. Denn mit diesen Fotobeschreibungen geht einher, dass er die Eltern als komplexe Figuren zeigt, als Opfer von sozialer Determination und von sozialer Gewalt und nicht mehr nur als Täter an dem Sohn. Bei der Mutter kommt noch dazu, dass er anfängt, das eigene Zutun an der sozialen Unterdrückung ihr gegenüber mit zu reflektieren. Bei Louis dienen die Fotos als Auslöser, eine zusätzliche Ebene oder einen zusätzlichen Aspekt der sozialen Wirklichkeit wahrzunehmen, auf den er unerwartet trifft. (..) Hier wäre das eben das Glücklichsein seiner Mutter, auf das er unerwartet trifft, das ihn aber auch insofern verwundert, trifft und besticht, als es ein vergangenes und auch ein zerstörtes Glück ist.“
Ausschnitte aus der anschließenden Gesprächsrunde
Claudia Walkensteiner-Preschl: Im Filmischen, sei es Fiktion, sei es non-Fiktion, ist die Suche und Recherche ein wesentlicher Part. Auch in der Literatur hat es verschiedene Phasen gegeben, über soziale Wirklichkeiten genauso wie über hierarchische klassenbedingte Realitäten zu schreiben. Was ist jetzt wirklich das Neue daran? Möglicherweise ist es wirklich die Verwendung der Materialien, diese Hybridität, dieser Bezug zur Fotografie?
Christina Ernst: Die Suche nach Materialien, die Beweischarakter haben oder ein weiteres Nachdenken auslösen, wird in den Texten ganz stark ausgestellt. Der Prozess selbst wird ganz stark herausgestellt und ist in diesen Texten nachvollziehbar. Ein Unterschied zum klassischen Realismus in der Literaturgeschichte ist dieser starke Ich-Einsatz durch die Erzählperspektive und auch die Inszenierungen von Autorschaft, die einen Authentizitätscharakter hervorrufen. Authentizität ist ein schwieriges Konzept, das man kritisch befragen muss, weil es auch erst hergestellt wird.
Nina Kusturica: Wie fluide darf eine Autosoziobiografie sein? Chantal Jaquet hat gesagt, wir denken zu binär: Es gibt eine Unterklasse und eine obere, es gibt einen Aufstieg und einen Abstieg. Was ist mit diesen vielen Zwischenschritten, die es in den Biografien gibt? Wie sind die zu besprechen? Ich frage mich auch, ob zur Autosoziobiografie auch ein Klassenabstieg dazugehören kann?
Christina Ernst: Vielleicht ist es auch gut, diesen autosoziobiografischen Begriff, der sich ja gerade erst etabliert und ausgehandelt wird, eher offen zu halten und explorativ zu verwenden. Es geht um ganz spezifische Schreibweisen, politische Haltungen. Es geht um soziale Fragen, um Gesellschaftsverhältnisse in einem weiteren Sinne. Es ist nicht nur eine Familiengeschichte, wo es um eine individuelle Familie geht. Sobald, in welcher Form auch immer, ein größerer gesellschaftlicher oder sozialer Rahmen aufgemacht wird, müssen es auch nicht unbedingt Texte, Filme, Erzählungen sein, die sich mit einem Aufstieg aus der Arbeiter*innenklasse in das Bildungsbürgertum befassen, sondern es können auch andere Konstellationen sein. Klassenabstiege sind die Erzählungen, die es mehr braucht und die jetzt auch noch mehr kommen. Denn diese klassische Aufstiegserzählung hängt bei Eribon und Ernaux mit ihrer Generation zusammen, mit den 60er, 70er, 80er Jahren, wo es in verschiedenen europäischen Ländern leichter war, einen Bildungsaufstieg zu machen, auch wenn man nicht schon aus einem Akademikerelternhaus kam. Das geht immer mehr zurück und Klassengegensätze verfestigen sich wieder mehr, die soziale Herkunft spielt sowieso nach wie vor, aber auch immer stärker, eine Rolle.
Camilla Henrich: Du hast von politisch engagierter Literatur gesprochen. Das Schreiben oder auch dieser wissenschaftlich anmutende Zugang ist ein Werkzeug um Realität abzubilden, welche Motivation steckt dahinter?
Christina Ernst: Was alle der Texte ganz stark machen ist, wie wichtig die Vorbildwirkung von ähnlichen Erzählungen, von ähnlichen Texten, von ähnlichen Geschichten war, um diesen eigenen Lebensweg denken zu können. Das wäre so eine erste politische oder emanzipatorische Ebene. Was man auch noch nennen könnte als politische Motivation, ist, dieses Klassenthema wieder in den Fokus zu rücken. Dass diese Texte so breit rezipiert und besprochen worden sind, hat sicher auch mit hineingespielt, dass wieder mehr über Klasse gesprochen wird. Auch auf eine spezifische Art, weil Aspekte wie diese ganzen Fragen zu Scham oder diesem Gefühl der Distanz zur Herkunft, das auch mit Affekten wie Scham usw. behaftet ist. Oder auch die Frage nach dem Habitus, zu körperlichen Aspekten von Klasse. Das ist dadurch irgendwie anders beschreibbar geworden.
Barbara Wolfram: Mich beschäftigt bei den Beschreibungen von Fotos die Frage nach dem Umfeld der Fotografie. Irgendjemand hat dieses Foto gemacht, hat ausgewählt, was fotografiert wird und die andere Person hat auch gemerkt, dass sie fotografiert wird. Ist das für dich in deinen Überlegungen interessant? Ich finde, dass dieses Bezugnehmen im Text einen Beweis auch spielt. Dass ein Foto auch ein konstruierter Beweis ist, von einer sehr konstruierten Situation, auch wieder von einem Ausschnitt.
Christina Ernst: Wobei dieser Beweischarakter der Fotografie für die Autor*innen im Schreibprozess wichtiger ist als für mich als Literaturwissenschaftlerin. Da ist es insofern nicht so wichtig, weil natürlich jeder Beweis, jede Spur in einem literarischen Text, in einer Erzählung etwas Konstruiertes hat. Ich finde spannend, wie die Texte diese Fotografien einsetzen. Erstmal ist es natürlich ein Beweis oder Archivmaterial für sie im Schreibprozess, aber dann wird der Beweis quasi an die Rezipient*innen weitergereicht, indem die Fotos abgedruckt werden oder nachträglich auf Instagram gepostet werden.
Elena Meilicke: Mir ist aufgefallen, dass, sowohl bei Ernaux als auch bei Eribon, Kinofilme genannt wurden. Bei Eribon war es „Alles über meine Mutter“ von Almodóvar und bei Ernaux war es eine ganze Reihe von Filmen, wo sie auch ganz emphatisch sagt: das waren Filme, die ich mit mir anschauen musste, bevor ich mit dem Schreiben beginnen konnte. Spielt das Kino, spielen Filme für das Schreiben dieser Autosoziobiografien eine Rolle?
Christina Ernst: Filme spielen auf jeden Fall eine Rolle, ähnlich wie literarische Texte. Wenn Eribon „Alles über meine Mutter“ erwähnt, dann ist es so was wie ein Vorgängertext, eine Erzählung, die bei ihm, wenn er den Film sieht, eine Reflexion über seine Eltern auslöst. Als Erzählung, die der eigenen Erzählung vorgängig ist. Was bei Ernaux in vielen Texten vorkommt, sind Hinweise auf Kinofilme aus der Zeit, über die sie geschrieben hat – neben den Chansons und teilweise auch Texten oder Zeitschriften, die sie gelesen hat. Das soll ein zeithistorisches und auch lokal situiertes Kolorit erzeugen, wo unter anderem über Filmtitel ein Setting geschaffen wird. Das ist ein bisschen analog zu den Fotobeschreibungen. Ähnlich wie sie Fotos beschreibt, beschreibt sie manchmal auch einfach Szenen. Ein Versuch, so ein sozial markiertes Zeitgefühl einzufangen.